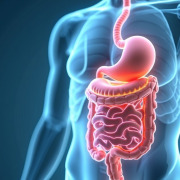Homöopathische Einzelmittel in Potenzen größer D30 können theoretisch keine materielle Wirkung entfalten, weil sie praktisch kaum noch Moleküle irgendeiner Wirksubstanz enthalten. So argumentieren die Gegner der Homöopathie und haben erst einmal recht damit. Doch dabei berücksichtigen sie nicht die feinenergetisch-informative Wirkung auf die Überträgersubstanzen des Mesenchyms. Dies gilt insbesondere für Wassermoleküle, die entlang der Polysaccharid-Moleküle im Mesenchym gebunden sind.
Dass Wasser ein „Gedächtnis“ hat, darüber ist in den letzten Jahren viel gearbeitet worden. Wer sich für das Thema aus einer eher physikalischen Sicht interessiert, mag zum Beispiel hier gute Anregungen finden:
- https://www.mpip-mainz.mpg.de/strukturelle_Gedaechtnis_von_Wasser
- https://www.youtube.com/watch?v=ZVvwW2NZR-A
Dabei geht es nicht um die einzelnen Wassermoleküle, sondern um Molekülgruppen beziehungsweise Molekül-Cluster, die in ihren Formen speziell sterisch-räumlich angeordnet sind. Es geht dabei um die räumliche Ausdehnung des Moleküls, die einen Einfluss auf chemische Reaktionsverläufe hat. Das ist eine sehr spezielle Eigenschaft des Wassermoleküls, die möglicherweise auch Ursache der vielen Besonderheiten des Wassers ist.
Mithilfe von photonenemissionsanalytischen und laserspektralanalytischen Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass Homöopathika tatsächlich Einfluss nehmen auf die Clusterstrukturen von Verbindungen, die Wassermoleküle enthalten. Insbesondere geht es dabei um deren sphärische Winkelanordnungen. Die Wassermoleküle ordnen sich dann gern in räumlichen Gruppen von 15 – 25 Molekülen an. Diese Molekül-Cluster sind in der Lage, andere Stoffe sowie einzelne Elektronen vorübergehend aufzunehmen, was einer Transportfähigkeit gleichkommt und darüber hinaus die Möglichkeit bietet, die Elektronen- und Photonenemissionen zu ändern.
Wenn Wasser durch Verdampfen in den gasförmigen Zustand übergeht, werden die Molekül-Cluster immer kleiner bis hin zu Einzelmolekülen. Diese „Zerschlagung“ passiert auch bei der Levitierung nach Hacheney und bei Versprühung auf Stein. Und damit sind wir endlich bei der manuellen homöopathischen Verschüttelung angelangt, die physikalisch als Kombination starker Beschleunigungen und Rotationen aufgefasst werden kann.
Je kleiner nun dabei die Cluster werden, desto mehr feinenergetische Informationen in Form von Elektronen und Photonen können an die Molekülstrukturen geknüpft werden, was eben gerade bei den höheren Potenzen geschieht. Salopp gesagt könnte man den Prozess mit einer Oberflächenvergrößerung vergleichen, an die beispielsweise mehr Giftstoffe angeheftet und abtransportiert werden können.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Vor allem wenn Sie für den Erhalt der Homöopathie sind, sollten Sie sich unbedingt dazu eintragen, denn die „Politik“ und etablierte Medizinerschaft ist bestrebt die Homöopathie zu verbieten und / oder abzuschaffen!
Man geht daher davon aus, dass sich levitiertes Wasser beziehungsweise Wasser aus steinigen, sprudelnden Bächen besonders gut für die Informationsübertragung eignet. Jene Wassermoleküle haben bereits ihre Veränderbarkeit bewiesen und gar eingeübt, was sich auf die Qualität des Informationsaustausches des Mesenchyms sehr positiv auswirkt.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom interstitiellen Raum beziehungsweise vom Pischinger-Raum. Zusätzlich sind im Mesenchym, das als der eigentliche Wirkungsort der Homöopathika angesehen wird, hochmolekulare Polysaccharide angesiedelt, die bei neutralem pH-Wert weitestgehend parallel zueinander ausgerichtet sind.
Entlang dieser relativ großen Moleküle und deren Ladung folgend wird der Stofftransport organisiert, was dann besonders effektiv vonstattengeht, wenn die Stoffe selbst nicht elektrisch neutral sind. Auch Wassermolekül-Cluster, die Elektronen oder Koppel-Moleküle mit sich tragen, werden so entweder besser oder schlechter geführt. Insofern hängt der Informationsaustausch im Mesenchym durchaus von der Polysaccharidstruktur sowie von der elektrischen Ladung und den damit verbundenen Spannungen im Mesenchym ab.
An dieser Stelle kommen aber noch das Redoxpotential der mesenchymalen Flüssigkeit, ihr elektrischer Widerstand beziehungsweise ihre elektrische Leitfähigkeit und ihr jeweiliger pH-Wert mit ins Spiel. Sie ist daher fast hauptverantwortlich für die inneren Transportvorgänge und die Anpassungsfähigkeit des Organismus.
Das Milieu nimmt Einfluss auf die homöopathische Konstitution
Eiweiße und Schwermetalle zeichnen sich durch eine positive Oberflächenladung aus. In der Folge heftet sich beides sehr fest an die mesenchymalen Strukturen, wodurch sie aber deren elektrische Oberflächenspannung verändern. Bereits Hahnemann hatte klar erkannt, dass zum Beispiel Quecksilber intensiv lymphatisch blockierend wirkt, ebenso wie Eiweiße, die H+ Ionen abgeben und sich so mesenchymblockierend darstellen. Insofern lässt sich in diesem Zusammenhang mit Fug und Recht von einer Milieubelastung sprechen, die die Informationsaufnahmefähigkeit und den Stofftransport des Mesenchyms deutlich reduziert, wenn nicht sogar ganz aushebelt.
In der Folge ist der Patient kaum noch für informativ-feinstoffliche einzelmittelhomöopathische Therapien zugänglich. Dies zeigt auch die klinische Erfahrung so. Die Ansprechbarkeit für jegliche Informationstherapie kann durch eine mesenchymale Vorbehandlung in der Art einer Milieu- oder orthomolekularen Therapie, eines Säure-Basen-Ausgleichs oder einer Isopathie ganz erheblich gesteigert werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der moderne Mensch in der westlichen Welt aufgrund seiner chronischen Eiweiß- und Schwermetallüberbelastung auf einzelmittelhomöopathische Informationstherapien gar nicht richtig ansprechen kann.
In der Konsequenz muss jeder Patient vor der einzelmittelhomöopathischen Behandlung mit einer orthomolekularen Therapie, einer Isopathie und einem Säure-Basen-Ausgleich vorbehandelt werden. Maßnahmen, die sich in diesem Zusammenhang besonders gut bewährt haben, sind Gaben von Mineralstoffen, Salzen und Metallen in materiellen Konzentrationen. Als Beispiele seien hier explizit genannt:
- Magnesium
- Orotsäure
- Silizium
- Kalium
- Mangan
- Molybdän
- Kalzium
Besonders hervorheben möchten wir hier den orthomolekularen Einfluss von Magnesium auf das parasympathische Nervensystem. In diesem Fall findet eine Sympathicus-Verminderung statt und durch Kalium wird eine Parasympathicus-Verstärkung erreicht, wodurch die Feinregulation sowie die Ansprechbarkeit auf Homöopathie eindeutig begünstigt werden.
Was in diesem Rahmen nicht unerwähnt bleiben sollte
Zink wirkt katalytisch, also reaktionsfördernd, ohne sich selbst direkt in die chemischen Verbindungen „einzumischen“. Organische Substanzen wie Chinone oder Acidumphosphoricum kommen durchaus im normalen Zellstoffwechsel in sehr geringen Konzentrationen vor und bilden eine Interferenz mit Einzelhomöopathika aus. Dies zeigt einmal mehr, dass unser Zellstoffwechsel grundsätzlich jede homöopathische Therapie beeinflussen muss. Es ist leider ein völlig vernachlässigter Aspekt bei den meisten homöopathischen Therapien.
Jede Ernährungsumstellung, Entgiftung oder orthomolekulare Therapie beeinflusst unsere Art zu denken, unser Wesen und die Stoffwechselreaktionen, eben auch im Gehirn. Wer toxisch belastet ist, unter chronischen viralen Infektionen leidet oder eine chronische mesenchymale Verschlackung, die im Volksmund gern als Übersäuerung bezeichnet wird, aufweist, denkt, handelt und empfindet anders als ein gesunder Mensch.
Die durch eine Repertorisierung aufgefundene Konstitution entspricht oftmals nicht der wahren Wesensart und Konstitution des Patienten, die sich erst nach einer längeren Milieutherapie wieder einstellen. Und in der Tat erweist sich diese Erkenntnis immer wieder ganz konkret in der Praxis als richtig. Menschen finden nach der Ernährungsumstellung oder Entsäuerung einen ganz neuen Zugang zu ihren Lebensthemen.
Es bleibt also festzuhalten, dass eine tiefgehende homöopathische Wirkung von Einzelmitteln nur nach einer Stoffwechseleinstellung und milieutherapeutischen Körperreinigung richtig funktionieren kann. Außerdem kommen wir in der Sache um einen gewissen Paradigmenwechsel nicht herum. Viele klassische Homöopathen setzen auf die Ausschließlichkeit, auf die „reine“ Homöopathie, soll heißen, auf keinen Fall andere Begleittherapien parallel fahren. Das ist deshalb Unsinn, weil, wie schon weiter oben erwähnt, in unserem Stoffwechsel fortwährend in nicht zu geringem Maße Substanzen entstehen, die unter anderem auch als Homöopathika wirken können.
Im Grunde genommen ist damit der Beweis erbracht, dass unsere Art der Ernährung und unsere Stoffwechsellage einen ganz intensiven Einfluss auf das Konstitutionelle nehmen und das Denken sowie das Wesen des Patienten untrennbar von homöopathischen Prinzipien zu bewerten sind.
Dieser Gedanke führt uns noch einen Schritt weiter: Wenn Menschen tierische Produkte in materiellem Maße zu sich nehmen, inkorporieren sie einen Teil der Wesensart des Tieres, also auch dessen homöopathische Konstitution, die das Erbgut im Sinne einer endobiontischen und viralen Belastung beeinflusst. Das mag den einen oder anderen an den guten alten Spruch erinnern: „Du bist, was Du isst.“
Es ist daher höchste Zeit, dass auch in den einzel- und mittelhomöopathischen Kreisen begriffen wird, dass Milieutherapie und orthomolekulare Medizin eine Grundlage für die biologische Medizin sein müssen. Erst darauf aufsetzend wird das Homöopathikum gern im Sinne der Therapiekrönung zur vollen Entfaltung kommen. Insofern muss man sich eben überhaupt nicht darüber wundern, dass homöopathische Hochpotenz-Therapien fantastische Ergebnisse zeitigen, vorausgesetzt, die konstitutionelle Situation des Patienten wurde zuvor in optimaler Weise geradegerückt.
Anders ist die Situation allerdings bei der breit kombinierten Milieutherapie, mit der die Beschwerdebilder von nahezu 80 Prozent der chronischen Erkrankungen innerhalb von 6 Monaten deutlich verbessert werden können. Es ist wirklich die segensreiche Kombination aus mehreren biologisch-medizinischen Methoden und der Einzelmittel-Homöopathie im Verein mit einer vegetarischen Ernährungsumstellung, die das optimale Vorgehen in diesen Zeiten repräsentiert.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Vor allem wenn Sie für den Erhalt der Homöopathie sind, sollten Sie sich unbedingt dazu eintragen, denn die „Politik“ und etablierte Medizinerschaft ist bestrebt die Homöopathie zu verbieten und / oder abzuschaffen!